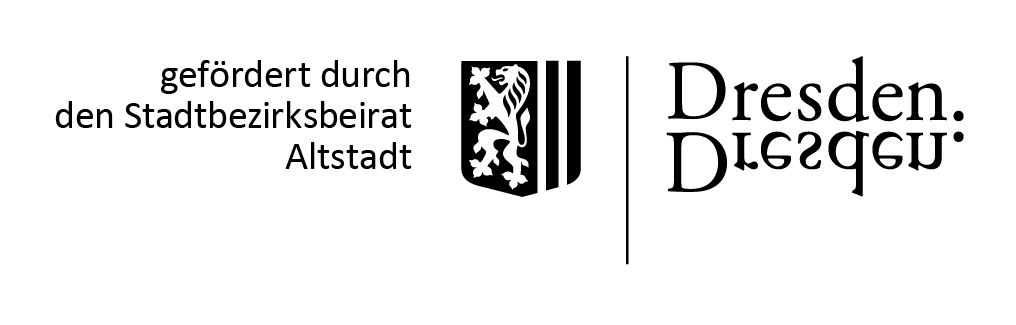Die Architektur des Pavillons selbst steht dabei sinnbildlich für das Anliegen: Eine große Schaufensterverglasung erlaubt jederzeit Einblick in den Schreibprozess. Was früher im Inneren der Synagoge stattfand, wird nun im Zentrum der Stadt sichtbar. Begleitet wird der Prozess durch Live-Übertragungen, Führungen und Gespräche.
Der erste Buchstabe wird am 21. August 2025 im Rathaus Dresden geschrieben – in einem Akt, der symbolisch und real zugleich ist: Das Rathaus, Ort städtischer Selbstverwaltung, wird zur Schwelle eines transkulturellen Projekts. Am selben Abend wird der Schreibpavillon feierlich eröffnet.
Religion als Teil der Stadtgesellschaft
Für die Jüdische Kultusgemeinde Dresden ist das Projekt mehr als ein symbolischer Akt. Es ist ein öffentliches Bekenntnis zur Sichtbarkeit jüdischen Lebens in der Stadt – nicht als Folklore oder Rückblick, sondern als gegenwärtige, zukunftsgerichtete Praxis.
»Die ewige Schrift« versteht sich in drei Dimensionen:
als Kulturprojekt, das die Thora in den Kontext der Schriftkultur und des Weltkulturerbes stellt, als Demokratieprojekt, das Bildung gegen Antisemitismus setzt und Räume der Begegnung schafft, als Ausdruck jüdischen Lebens, das offen, plural und dialogbereit ist.
Das Projekt bildet den konzeptionellen Rahmen für eine Vielzahl begleitender Ausstellungen, Veranstaltungen und Bildungsformate. Es wurde in enger Zusammenarbeit mit der Jüdischen Kultusgemeinde Dresden entwickelt. Ein besonderer Dank gilt dem Kooperationspartner, dem Stadtmuseum Dresden. Sein Engagement macht sichtbar, was kulturelle Verantwortung heute bedeuten kann: gemeinsam erinnern, gemeinsam gestalten.
Es entsteht ein Projekt, das Brücken baut – zwischen Religion und Öffentlichkeit, zwischen Vergangenheit und Gegenwart, zwischen Menschen.